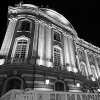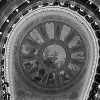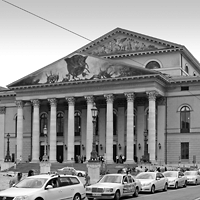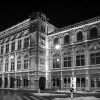Gespräch mit Dominique Meyer, Direktor des Théâtre des Champs-Élysées, am 22. Oktober 2006
Wie Oper in Frankreich gemacht wird

Dominique Meyer in Wien, 2012 (Foto: K. Billand)
Ein Besuch im Théâtre des Champs-Élysées (kurz TCE genannt) ist immer ein besonderer Augenblick. Nicht nur weil es ein schönes, sehr gepflegtes Theater im Art Nouveau Stil ist, sondern auch weil es einen besonderen Platz in der Musikgeschichte Frankreichs einnimmt. Im Eröffnungsjahr 1913 wurde Strawinskys “Sacre du printemps” unter Pierre Monteux in der Choreographie von Sergej Diaghilev uraufgeführt – einer der großen Musik-Skandale des 20. Jahrhunderts!
Bei der Pressekonferenz des TCE vor zwei Jahren beeindruckte Direktor Dominique Meyer, als er in seinem eineinhalbstündigen Vortrag die gesamte Saison in allen Details erklärte, ohne ein Blatt Papier vor sich zu haben. Aus dem südlichen Elsass stammend, Sohn eines Diplomaten (u.a. in Bonn), spricht Dominique Meyer perfekt deutsch. Er zieht aus einem Stoß Akten die letzte Nummer des Neuen Merker hervor, worauf ich ihm kurz erkläre, wie unsere Zeitschrift funktioniert. Darauf verlief das Gespräch besonders herzlich. Nun Auszüge aus dem fast zweistündigen Gespräch:
Herr Direktor, wie wird man künstlerischer Leiter eines Hauses wie das Théâtre des Champs-Élysées?
Während meiner Studienzeit an der Wirtschaftsuniversität besuchte ich täglich eine Oper, ein Theaterstück oder ein Konzert. Nach meinem Studium begann ich dann im Industrieministerium in der Sektion, die sich mit der Organisation und der Förderung der französischen Platten- und Filmindustrie befasste. Eines Tages lud mich der damalige Kulturminister Jack Lang zu sich. Nach einem vierstündigen Gespräch bot er mir einen Posten mit ähnlichem Wirkungskreis in seinem Ministerium an. Nach dem Ausscheiden Langs – wegen verlorener Wahl – fragte er mich, was ich machen wolle. Ich sagte ihm: einen kleinen Job an der Pariser Oper. Dort lernte ich Raymond Soubie kennen, damals Administrator der Pariser Oper. In dieser Rolle musste ich 1989 die Probleme um die Eröffnung der Bastille Oper sechs Monate später lösen, denn da gabs ja den berühmten Krach wegen Barenboims Vertrag – zwischen zwei Ministern unterschrieben – und der kam im schlechtesten Moment. Nachdem ich das gelöst hatte, holte mich Premierminister Beregovoy 1992 als Kulturberater. In dieser Funktion musste ich mich auch um alles Mögliche andere kümmern, nicht nur um Oper, sondern auch um die Gründung des deutsch-französischen Fernsehsenders ARTE, ja selbst Sport betreuen (die Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft 1998!). Das war etwas zu viel, und ich wollte wieder zurück ins aktive künstlerische Leben. Ich wollte ein “Häuschen” haben, kein großes Haus. Die Direktion der Oper in Lausanne war 1994 ausgeschrieben. Ich bewarb mich – und wurde prompt ernannt. Natürlich konnte (und wollte) ich nicht mit den großen Häusern wie der Oper in Genf, die nur 50 Minuten entfernt ist, konkurrieren. Es war eine sehr schöne Zeit, und ich hatte gute Möglichkeiten, Hunderte junge Sänger zu hören und einige auch zu engagieren. Die ganze Sängerriege, die jetzt im TCE singt (Ciofi, Bacelli, Kirchschlager, Pertusi, Regazzo, Spagnoli, Corbelli u.v.a.), habe ich damals in Lausanne zum ersten Mal vorgestellt. Ich habe das immer sehr genossen und seither viele junge Sänger gehört. So hatte der 26-jährige Francesco Meli, der hier kürzlich Don Ottavio sang, bei mir vor drei Jahren in Mailand vorgesungen. Er wird Ernesto in “Sonnambula” singen und demnächst Fenton.
1999 bot mir Raymond Soubie, der als Vorstandsvorsitzender des TCE inzwischen dessen Umbau und Renovierung geleitet hatte, die Leitung des Hauses an. Zuerst wollte ich nicht, denn ich fühlte mich sehr wohl in der Schweiz, doch nach einigem Zögern sagte ich zu, denn so eine Chance hat man nicht zwei Mal im Leben.
Wie funktioniert das Théâtre des Champs-Élysées?
Das TCE ist ein Privattheater und hat einen ganz eigenen Status. Die Caisse des Dépôts et Consignations )diese typisch französische Institution ist ein öffentliches Kreditinstitut, das die finanziellen Interessen des Staates und der Regionen verwaltet, u. a. die Millionen Sparbücher, Renten, sozialen Wohnbau, usw.) ist Besitzer des TCE, ist aber mit 5 Millionen Euro auch der Mäzen Nr. 1 des Theaters, wovon allerdings 1 Million Euro als Miete zurückerstattet und zur Instandhaltung des Hauses verwendet wird. Sonst haben wir keine weiteren öffentlichen Mittel. Die im Theater spielenden Orchester (das Orchestre National de France, das Ensemble Orchestral de Paris, das Orchestre Lamoureux, die zahlreichen Gastorchester – u. a. die Wiener und New Yorker Philharmoniker) und andere künstlerische Gruppen – vor allem Instrumentalsolisten und Tanz – mieten über Konzertbüros den Saal. Diese Einkommen erlauben uns, eigene Produktionen im TCE zu machen, oft in Zusammenarbeit mit anderen Theatern. Einmal im Jahr spielt das Orchestre National von Radio France für uns gratis als Entgelt für die Übertragungsrechte der Radioorchester.
Welche Schwerpunkte sehen Sie für das Théâtre des Champs-Élysées?
Ich hatte mir die Frage gestellt: stehen wir am Ende eines Weges? Man spielt überall immer das gleiche Repertoire, es kommt nur sehr wenig Neues hinzu. Man sollte das Repertoire erweitern, auch mehr Barockopern bieten. Neue Opern müssen geschaffen werden, aber nicht solche, die nach ein paar Vorstellungen vom Spielplan verschwinden. Die Komponisten (und Librettisten) müssen verstehen, für wen sie Musik schreiben. Viele Künstler haben das Publikum vergessen.
Deshalb haben wir im Laufe der Jahre ein System von Zyklen erarbeitet, die sich um einige wenige Schwerpunkte drehen, die von den anderen Pariser Häusern nicht oder wenig gepflegt werden, grosso modo Opern und Oratorien von Monteverdi bis Rossini, d.h. bis zur italienischen Romantik. So haben wir u.a. mehrjährige Monteverdi-, Bach- und Händel-Zyklen. Als Verlängerung sind die Tudor-Opern Donizettis zu sehen. Weiters spielen wir jedes Jahr eine Oper des 20. Jahrhunderts. Wir hatten deshalb Strawinskys “Rake's Progress”, Brittens “Turn of the Screw” und Debussys “Pelléas et Melisande”. Schließlich wird viel Kammermusik gespielt sowie Liederabende, meist von auswärtigen Organisatoren.
Wir haben dabei ein Netz von Zusammenarbeit gewoben, u.a. mit der Linden-Oper in Berlin, dem Monnaie in Brüssel, der Oper in Lyon und Evelino Pidò, dem Casals Festival in Prades und teilweise mit dem Festival d'Aix. Wir haben nämlich herausgefunden, dass etwa 15 % unserer Abonnenten nach Aix zum Festival fahren. Wenn ich also eine Produktion aus Aix in der folgenden Saison hier spiele, kommen viele nicht. Deshalb bringen wir solche Produktionen meist erst zwei oder drei Jahre später. Zahlreiche Barock-Ensembles sind natürlich privilegierte Gäste, wie “Les Talens Lyriques” von Christophe Rousset, René Jacobs mit “Concerto Köln”, William Christie und “Les arts florissants”, Jean-Claude Malgoire und “L'Écurie et la Chambre du Roy” und seit kurzem, Emanuelle Haïm mit “Le Concert d'Astrée”, sowie mehrere andere. Diese Konstanz ermöglicht eine langfristige Planung. Das Publikum scheint diese Stabilität zu schätzen und folgt sehr interessiert dieser Entwicklung.
Welche Pläne haben Sie für die nächsten Jahre?
Die Politik der Barockoper, die das Publikum sichtlich schätzt, wird weiter geführt werden. Wir werden jedoch in den nächsten Jahren in zwei Richtungen ausschweifen: einerseits die Opern von Lully, von denen viele nie gespielt werden. In der Saison 2007/08 “Thésé” – seit der Uraufführung wahrscheinlich nie mehr gespielt – unter Emmanuelle Haïm in einer Inszenierung von Martinoty und im Jahr drauf wird Lullys “Armide” unter der Leitung von William Christie und einer Regie von Robert Carsen gezeigt werden. Eine weitere Reihe wird in Zukunft die norddeutsche Barockmusik sein, spezifisch Werke von Telemann und Kaiser, die Christoph Rousset am 6. April 2007 mit Kaisers “Brockes Passion” beginnt. Auch werden wir einige Weihnachts-Oratorien und Passionen spielen, die nicht von Bach sind. Der Händel-Zyklus wird mit “Giulio Cesare in Egitto” und “Ariodante” (eine Koproduktion mit dem Theater an der Wien) in je fünf szenischen Aufführungen weiter geführt werden.
Den in der abgelaufenen Saison mit “Roberto Devereux” eröffneten Zyklus um die Tudor-Opern Donizettis, werden wir im Herbst 2007 mit “Maria Stuarda” fortführen und ein Jahr später mit “Anna Bolena”. Eine konzertante Aufführung der “Sonnambula” mit Nathalie Dessay in der kommenden Saison wird diese Tendenz verstärken, wie vergangenes Jahr die szenische Aufführung von Rossinis “Semiramide”. Was die Oper des 20. Jahrhunderts betrifft, werden wir die sehr erfolgreiche konzertante Aufführung von Debussys “Pelléas et Melisande” im Jahr 2000 unter Bernhard Haitink, diesmal aber szenisch (mit André Engel / Nicky Rieti) für fünf Abende wiederholen.
Das alljährliche dreitägige Festival “Prades aux Champs-Élysées” im Jänner ist ein Höhepunkt des Pariser Musiklebens und der Fixstern, um den sich die kammermusikalische Seite des Hauses dreht. Natürlich werden die zahlreichen anderen Pianisten, Geiger, Kammerensembles wie zum Beispiel das Alban Berg Quartett oder das Ensemble Wien und Sänger, die seit Jahren im TCE zu Hause sind, von verschiedenen Konzertagenturen wieder geboten werden.
Herr Direktor, eine heikle Frage: welches Verhältnis haben Sie zu den Regisseuren?
Eines unserer schwierigsten Probleme ist es, passende gute Regisseure zu finden, die nicht nur Musik und Libretto kennen, sondern auch den Geist, die Essenz des Werkes verstehen. Man kann Händels “Agrippina” als ein Drama der Macht ziemlich modern inszenieren, wie es David McVicar brillant gelöst hatte, denn das ist ein zeitloses Problem. Aber z.B. “Le Nozze di Figaro” in einer “modernen” Inszenierung zu bringen, ist Unsinn. Das Werk steht völlig im 18. Jahrhundert, der Aufklärung, der Revolution, der Auflehnung gegen den Absolutismus. Man darf nicht vergessen, dass Mozart und Da Ponte mit ihrer Trilogie die textliche Behandlung der Oper völlig umgeworfen haben. Es werden nicht mehr mythologische oder historische Stoffe vertont, es ist “zeitgenössische” Literatur. Beaumarchais Stück war in Wien verboten, selbst unter dem aufgeklärten Kaiser Joseph II. Es ist revolutionär. “Io non impugno mai quel che non so.” Das sagte kein Bauer, kein Diener zu seinem Herrn! Jean-Louis Martinoty und Hans Schavernoch haben diesen politischen Hintergrund völlig verstanden. Wir haben diese Produktion schon drei Mal erfolgreich aufgenommen und werden sie sicher noch einmal wiederholen.
Ich nehme mir immer viel Zeit, den richtigen Regisseur zu finden, um die völlige Zusammenarbeit mit dem Dirigenten zu gewährleisten. Bisweilen ist es schief gegangen. Aber das war immer, wenn die Produktion von auswärts kam und ich nicht den Regisseur wählen konnte.
Wie sehen Sie die Zukunft des Opernbetriebs?
Das ist ein großes Problem. Ich habe darüber voriges Jahr beim Europäischen Forum Alpbach gesprochen. Eines der Probleme ist das Altern des Publikums. Noch zu meiner Zeit – und zu Ihrer vermutlich noch mehr – waren viel mehr junge Leute in der Oper. Dabei ist der Andrang in den Opernhäusern größer geworden. Man muss mehr Kinder in die Oper bringen. Leider lässt die schulische Musikerziehung in Frankreich zu wünschen übrig. Wir spielen deshalb jedes Jahr eine Kinderoper (wie auch in der Bastille und im Châtelet). Die Klassenlehrer werden angeregt mitzumachen und auf den Besuch vorzubereiten (wie im Vorjahr bei “Der Kleine Rauchfangkehrer” von Britten). Das Musiktheater sollte direkt mit der Schule zusammen arbeiten; nicht nur um das Publikum von morgen zu entwickeln, sondern auch um neue Künstler zu bilden.
Natürlich muss dem auch eine entsprechende Preisgestaltung für Jugendliche und Studenten entsprechen. Wir haben 80 Plätze zu fünf Euro sowie Studentenprogramme zu acht Euro und 120 Plätze zu zwölf Euro.
Ein weiteres Problem ist die Programmgestaltung ganz allgemein. Man spielt immer und überall dasselbe Repertoire mit denselben 60 bis 70 Opern und oft mit denselben Sängern. Viele wichtige Werke sind praktisch vergessen. Selbst “populäre” Komponisten haben weniger bekannte Werke geschrieben, die nicht notwendigerweise schlecht sind. Und das gilt selbst für solche “Stars” wie Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi oder Puccini! Und das seit Jahrzehnten. Es beginnt etwas besser zu werden, und wir hoffen, mit unserem Barockopern-Zyklus zur Auffrischung des Repertoires beizutragen. Auch mehr zeitgenössische Opern sollten gespielt werden, aber nicht nur vier oder fünf Mal, das ist nicht genug. Man muss sie dann zwei oder drei Jahre später wieder bringen, sonst ist das ein Schlag ins Wasser. (NB: Diese Politik wurde in der Bastille Oper in der Ära von Hugues Gall erfolgreich praktiziert).
Es wird sich auch demnächst die Frage der Ensemble-Häuser stellen, vor allem in Deutschland. Dort muss man sich fragen, ob man so viele Ensemble-Häuser braucht. Es gibt auch andere Wege, wie z.B. das Grand Théâtre de Genève zeigt. Wir sollten die Opernhäuser nicht mehr behalten wie Kinder ihr Spielzeug. Allerdings gibt es einen bedauernswerten Zusammenhang zwischen den Finanzproblemen der Kommunen und den Opernhäusern. Wir haben keine Opernkrise, sondern eine Finanzkrise der Opernhäuser!
Herr Direktor, wir wünschen Ihnen in Zukunft weiterhin viel Erfolg und danken für dieses interessante Gespräch.
Wilhelm Guschlbauer und Klaus Billand / im November 2006
Das obige Gespräch wurde zunächst von mir anlässlich meines Besuches des Théâtre des Champs-Élysées in Paris geführt, nachdem ich dessen Intendanten Dominique Meyer auf dem Europäischen Alpbach-Forum 2005 in Innsbruck kennengelernt hatte, wo wir in Panels zur Frage der Zukunft der Oper als Kunstform im neuen Jahrtausend teilnahmen. Im Oktober 2006 besuchte ich Paris für die „Götterdämmerung“ in der Regie von Robert Wilson unter der musikalischen Leitung von Christoph Eschenbach am Pariser Théâtre de Châtelet sowie dem „Don Giovanni“ in der Regie von Michael Haneke am Palais Garnier zu Mozarts 250. Geburtstag und verband damit den Besuch des Théâtre des Champs-Élysées, auf Einladung von D. Meyer im Jahr zuvor.
Wilhelm Guschlbauer (+), der damalige Merker-Koordinator für Frankreich mit Sitz in Paris, erweiterte dieses Gespräch später mit interessanten Details aus dem französischen Opernleben. Es erschien schließlich im Neuen Merker im November 2006 mit einem Foto von Dominique Meyer auf der Titelseite und spielte möglicherweise bei den Überlegungen zur Neubesetzung des Direktors der Wiener Staatsoper 2010 eine Rolle.
Klaus Billand