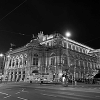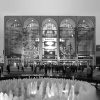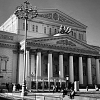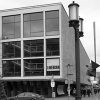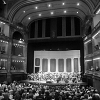Peter Konwitschny zum Musiktheater im Palast der Künste in Budapest (MÜPA) - 21. Juni 2015
Lebendiges oder totes Theater?!

Peter Konwitschny beim Vortrag
Am Folgetag der Premiere des „Fliegenden Holländer“ im Béla Bartok Saal des Palasts der Künste hielt der Regisseur Peter Konwitschny ebendort einen Vortrag zu seiner Sicht des – wie er es nennt – lebendigen oder toten Theaters. Die Veranstaltung war sehr gut besucht.
Peter Konwitschny war schon einmal 1975 in Ungarn im Zusammenhang mit einer Produktion von Heiner Müller. Seither besteht eine Liebe zwischen ihm und den Ungarn. Er freut sich über die Rückkehr und will demnächst eine „interessante Sache“ mit Ádám Fischer hier im Palast der Künste machen. Er begrüßt Eva Marton, die in seiner Hamburger Inszenierung des „Lohengrin“ die Ortrud verkörperte. Dieser „Lohengrin“ war nicht „blöd“, wie verschiedentlich bemerkt worden ist, sondern sehr humorvoll. Er war viel ernster als eine Aufführung, bei der die Sänger nebeneinander stehen und singen.
Sänger bewegen sich, manchmal dreht sich auch die Bühne, aber das Theater ist trotzdem tot. Oper ist aber subversiv, nicht primär durch ihre Themen, sondern dadurch, dass gesungen wird. In unserer fortgeschrittenen Zeit wird das Singen tabuisiert. Man könnte verhaftet werden, wenn man auf der Straße singt. Singen erinnert jedoch an die Verbindung von Kopf und Herz. Es ist eine Einheit. Kein einziges Detail oder Thema furnktioniert, ohne den Gesamtzusammenhang zu erfassen – und dazu ist Oper eine gute Schule. Peter Konwitschny hält es für ein Verbrechen, die Bühne zu gebrauchen. Theater hat für unsere Bildung eine große Rolle gespielt. Bildungsbürger mussten ins Theater gehen. Theater brachte Griechenland zu erster Blüte. Das betrifft auch uns heute noch so. Deshalb ist es ein Verbrechen, sich auf die Bühne zu stellen, ein paar „Tönchen zu trällern“, unabhängig von der Thematik des Komponisten. So wird „Pornographie betrieben, zum Selbstzweck“. Pornographie ist Selbstzweck.
Oper ist ein Korrektiv – sie bildet Menschen und bildete Menschen. Deshalb sind die Stücke gut. Konwitschny hat bisher nicht eines kennen gelernt, das schlecht war. Es gibt nur schlechte Aufführungen!
Er bringt einige bebilderte Beispiele zur Illustration seiner These:
Das erste Beispiel handelt vom 2. Akt „Jenufa“. Wenn Jenufa aufwacht und merkt, dass der Sohn nicht mehr da ist, ist sie auf der Bühne normalerweise mutterseelenallein. Sie ist aber nicht allein – Janacek ist bei ihr in Form der Solovioline. Man sieht in einer Inszenierung Konwitschnys die Geigerin nahe bei Jenufa, sie spielt wie in einem Dialog mit ihr. Es wirkt wie ein Duett. Konwitschny hat in vielen Inszenierungen mit vielen Musikern gearbeitet. Immer waren die Sologeiger beim Orchester im Graben. Es ist aber ganz anders, wenn der Geiger oder die Geigerin im Graben sitzt und man ihn oder sie nicht sieht. Musik muss aber inszeniert werden. Er will die Musik in die Szene „in“ szenieren. Das sei Werktreue. In Deutschland interessiert der Begriff „Werktreue“ schon seit 500 Jahren.
Theater ist eine wunderbare Sache, denn es entsteht dabei immer eine Wiederbelebung. Ist das Stück tot? Es steht da im Regal wie ein Skelett. Dann kommt ein Mensch, nimmt es heraus, und schon belebt es sich – in ihm. Die Menschen beleben das Stück, den Text. Sie erleben es mit ihrem eigenen Leben. Theater entsteht, wenn wir unser Leben dem Stück leihen. So kommt automatisch Gegenwart ins Spiel. Deshalb ist Theater immer gegenwartsbezogen. Wenn das verboten wird, entsteht totes Theater. Theater entsteht nicht, wenn das Theater mit Ehrfurcht und genauem Text abgebildet wird. Es ist absurd, ein Stück wie zur Uraufführung aufzuführen. Das ist theatralische Nekrophilie! Auch die Autoren, die alte Mythen bearbeiteten, haben diese verändert. Die Figur von Posa in „Don Carlos“ beispielweise gab es gar nicht wirklich. Posa gab es gar nicht!
Was ist Werktreue?! Da muss man zuerst fragen: Was ist Treue? Es gibt doch verschiedene Möglichkeiten, treu zu sein. Bin ich werktreu, wenn ich alles so mache, wie es da steht? Ja, wenn ich treu bin dem Buchstaben nach. Nein, wenn ich Treue definiere als „dem Sinn nachzugehen“. Als Verdi beispielsweise „Rigoletto“ komponierte, waren die Umstände jene von damals. Heute ist „Rigoletto“ in einem anderen Umfeld. „Rigoletto“ hat sich nicht geändert, aber die Umstände. „ALLES ist anders als 1851! Ich schwöre es Ihnen!“ Für Peter Konwitschny ist werktreu, wenn der Regisseur den Inhalt des Stücks zu unseren Zeitgenossen wieder herstellt.
Ein Beispiel aus Richard Wagners „Ring des Nibelungen“: In der „Götterdämmerung“ will Hagen im 3. Aufzug Siegfried den Ring vom Finger ziehen. Nach Wagners Regieanweisung steht da, dass Siegfried in diesem Moment die Hand mit dem Ring hebe. Ein Toter kann aber nicht die Hand heben. Es ist dennoch eine äußerst wichtige Regiebemerkung. Warum schreibt Wagner das? Er ist ein Politiker und Theologe – ein Moralist. Wenn Hagen den Ring bekommt, ist jede Hoffnung vorbei. So schreibt Wagner eine Paradoxie. Es ist an der Stelle ein ethischer Einspruch Wagners gegen den Realismus. Das darf nicht sein. Das theatralische Zeichen ist die Paradoxie der Handhebung des Toten. Wenn ich das weiß, wird das ein fundamentaler Moment im ganzen „Ring“. Aber der Kontext hat sich geändert. Heute ist kein Mensch mehr von der Erhebung des Armes eines Toten überzeugt, heute lachen wir darüber. Dann muss ich als Regisseur ein anderes Mittel für dieses Veto, ein anderes theatralisches Stilmittel benutzen, damit das Publikum begreift, worum es im „Ring“ geht. So habe ich genau in dem Moment das Licht im Zuschauerraum plötzlich hell werden lassen. Wenn der Tote den Arm hebt, ist das äußerste Dummheit bzw. Denkfaulheit des Regisseurs.
In „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartok wird Tür 5 gezeigt. 1911 war noch nicht so klar, dass die Männerwelt den Globus zerstört. Heute ist das viel viel klarer. Deshalb ist es albern, wenn sich hinter Tür 5 eine herrliche Landschaft zeigt. Musikalisch ist das die größte Stelle im ganzen Stück. Fünf ist etwa die Mitte. Der Mann bekommt Oberwasser, er wird stärker als die Frau. Durch seine omnipotente Haltung fliegt auch der Schutz weg, Judith antwortet zweimal – sie ist sprachlos. Wenn die zu sehende Landschaft schön wäre, wäre die Reaktion vermutlich eine ganz andere.
Der selbst denkende Mensch ist ein Politikum. Theater muss heute eine Struktur haben, die nicht vollständig ist wie eine Instantsuppe. Diese geht durch mich durch und lässt kaum etwas zurück. Es geht nicht los. Aber Oper geht los, weil und wenn der Dirigent mit dem Taktstock die Oper beginnt. Wenn jetzt etwas Ganzes entsteht, ist das die Leistung des Theaterbesuchers.
Ein Beispiel: „Eugen Onegin“ in Bratislava, wo Onegin mit dem toten Lensky in völliger Verzweiflung tanzt. Die Frage ist heute, was ein Ballett soll, die Polonäse, die an dieser Stelle komponiert ist. Was soll das heute? Man muss aber wissen: Tschaikowsky musste das Ballett schreiben, weil der Intendant ein Ballett wollte, wie beim „Tannhäuser“ 1861 in Paris. So fühlt sich Konwitschny als Regisseur im Recht, etwas anderes zu machen. Normalerweise strecht man das Ballett. In einer Inszenierung des „Don Carlos“ von ihm ist das Ballett überhaupt zum ersten Mal gespielt worden. Die Musik bei Tschaikowsky ist aber nicht streichbar, sie ist einfach zu gut. Also, was kann man Sinnvolles mit dem Ballett für die Gesamtgeschichte machen?? Alle wissen, da ist ein Ballett. Nun aber kommt die Korrektur. Konwitschny baut den Erkenntnisprozess in die Musik des Balletts ein. Onegin begreift bei dieser Musik, was er getan hat und tanzt mit dem Totem. Walter Benjamin sagt in den geschichtsphilosophischen Büchern: Man müsse die Geschichte gegen den Strich bürsten. Also aus dem Blickwinkel der Opfer heute sehen. Wenn der Begriff der Werktreue einen Sinn hat, ist es die Haltung der Autoren zur Wirklichkeit – der müssen wir treu sein. Musiktheater hat mit dem Schauspiel gemein, dass es auf einer Bühne stattfindet, und beide mit denselben Mitteln klar kommen müssen. Aber zum Mittel der Sprache kommt bei der Oper die Musik als zusätzliche Ebene. Zwischen dem dramatischen Theater und der Oper besteht en fundamentaler Unterschied. Schauspiel zu inszenieren heißt komponieren; Opern zu inszenieren heißt Musik zu inszenieren. Hier liegt die Krux des Musiktheaters. Selbst wenn nichts auf der Bühne ist, laufen die Opern. Im Schauspiel ist das gar nicht möglich.
Schließlich bringt Konwitschny noch ein Beispiel aus seiner Inszenierung des „Fliegenden Holländer“ in Graz. Während Senta im Fitnesscenter mit heutiger Sportkleidung ausgestattet ist, kommt der Holländer in einem Mantel aus des 17. Jahrhundert zu ihr. Das ist nur eine Umdeutung, damit die Zuschauer wissen, dass der Holländer aus einer anderen Zeit in Sentas, d.h. in unsere Gegenwart kommt. Das alte Brautkleid weist schon etliche Löcher auf, aber für Senta ist es das schönste Kleid ihres Lebens…
Da alle Beispiele ausführlich mit Video-Aufnahmen dokumentiert wurden, war Konwitschnys These den meisten gleich verständlich. Dennoch ergab sich anschließend noch eine hitzige Diskussion mit dem Publikum, insbesondere zum Begriff der Werktreue.
Peter Konwitschny schloss seinen interessanten Vortrag mit folgenden Worten ab:
„Es reicht nicht aus, keine Ideen zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszuführen“. Großer Applaus für den gesamten Vortrag!
Foto: Klaus Billand
Klaus Billand