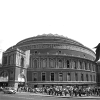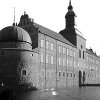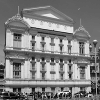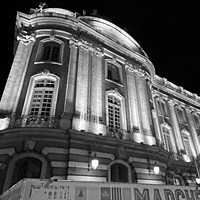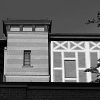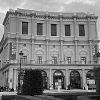Podiumsdiskussion „Revolution der Künstler“ an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - 23. Mai 2013

Elisabeth Kulman
Seit sich die mittlerweile weithin bekannte österreichische Mezzosopranistin Elisabeth Kulman öffentlich und in kritischer Weise zu den immer bedenklicher werdenden Missständen bei den Arbeitsbedingungen für OpernsängerInnen geäußert hat, rückte die im Februar 2013 von Musical-Produzent Johannes Maria Schatz ins Leben gerufene Facebook-Seite „Die traurigsten unverschämtesten Künstlergagen und Auditionserlebnisse“ in ein weiteres Licht der Öffentlichkeit. Am 16. März 2013 rief Kulman die KünstlerInnen zur „Revolution“ auf und erhielt umgehend breite Resonanz in den Medien. Mit dem selbstverpflichtenden Gütesiegel „art but fair“ wird nun für einen fairen und den KünstlerInnen gegenüber respektvolleren Umgang plädiert.
Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – mdw hat nun einen ersten öffentlichen Diskussionsabend zum Thema veranstaltet, an dem neben Elisabeth Kulman prominente Persönlichkeiten des Wiener Musiklebens teilnahmen, wie Dominique Meyer, Direktor der Wiener Staatsoper, Roland Geyer, Intendant des Theaters an der Wien, Samantha Farber, Sono Artists Consulting, Peter Edelmann, Bariton und Gesangsprofessor an der mdw, und schließlich der an der mdw Studierende Christoph Filler. Michael Gmasz moderierte die lebhafte Diskussion, nach deren Ende das zahlreich erschienene Publikum umfangreich zu Wort kam.

D. Meyer, S. Farber, P. Edelmann
Zu Beginn stellt E. Kulman die Situation dar und meint, dass gerade die Salzburger Festspiele ein Vorbild für angemessene Vergütung auch der Probenarbeit sein sollten, die Intendant Pereira bekanntlich gestrichen hat. Zwei Monate Proben in Salzburg sind eben auch künstlerische Arbeit, die bezahlt werden sollte, zumal man, falls man zur Aufführungsserie erkranken sollte, ganz leer ausgeht. Kulman beklagt auch, dass heutzutage in der Probenzeit kaum oder gar nicht mit den Regisseuren über Musik gesprochen werde. „Das deutsche Regietheater habe hier eine Problematik gebracht“. Und auch bei den Journalisten gebe es Kompetenzdefizite. Man solle wieder die Musik vor das Theater stellen. Daraufhin stellt Dominique Meyer fest, dass in der Kritik oft zuviel über Regieleistungen und zu wenig über die SängerInnen geschrieben werde. Auch gebe es oft nur ein Wort oder gerade mal einen Satz über den Dirigenten und die Orchester-Leistungen. „Das geht nicht!“ Oft werden die Beiträge am Ende geschnitten, dann fallen gerade die SängerInnen weg, die meist am Ende stehen, auch wenn Meyer betont – sicher nicht unwesentlich – dass er hier karikiere, dass es in der Musikstadt Wien besser bestellt sei als woanders.

Roland Geyer
Roland Geyer stellte – bei weitem nicht zu Unrecht – fest, dass die gegenwärtige Politik, getrieben von den allgemein zunehmenden Budgetzwängen, den Theatern immer engere Grenzen setzt und man deshalb immer wieder zu zusätzlichen Einsparungen gezwungen sei. Ob es dann zu einer höheren Gage oder der Bezahlung von Probengeldern kommt, sei Verhandlungssache. Peter Edelmann betont daraufhin, dass sich die SängerInnen im Opernbetrieb bisweilen wie ein Feind vorkommen, aber in Wahrheit wollten sie doch geliebt werden (wer will das nicht…?! – Anm. d. Verf.). „Wir wollen von allen, die im Opernbetrieb aktiv sind, getragen werden, und die Regisseure sollen den SängerInnen helfen“. De facto müssten aber manchmal die SängerInnen den RegisseurInnen erklären, was gemacht werden soll, und dabei werden die Probenzeiten immer länger… In den USA betragen sie normalerweise offenbar nur drei Wochen – „und das funktioniert auch“. Roland Geyer stellt sodann die Probenpolitik seines Hauses dar, die auf dem Prinzip (Gott sei Dank! – Anm. d. Verf.) beruht, dass Szene, Gesang und Musik gleich wichtig sind. Wichtig für gute künstlerische Ergebnisse sei das kollegiale oder gar familiäre Umfeld, in dem eine Produktion langsam entsteht und zur Reife kommt – das sei das Prinzip seines Hauses. Sicher spielt hier der Stagionebetrieb eine ganz wichtige Rolle gegenüber dem Repertoirebetrieb, der an der Staatsoper angesagt ist. Zu Recht pocht Geyer deshalb auf eine klare Trennung der beiden Produktions- und Aufführungsformen auch in dieser Frage.

Christoph Filler
Auch der Studierende des Baritonfachs Christoph Filler berichtet über einige negative Erfahrungen beispielsweise bei Auditionen, hat aber auch gute mit Proben gemacht. Das Gespräch entwickelt sich nun zu der interessanten Frage hin, ob überhaupt zu viele SängerInnen ausgebildet werden. Nach Roland Geyer und auch Peter Edelmann seien bei durchwegs hohen Bewerberzahlen die effektiven Aufnahmen aber sehr gering. Es finde ein sehr qualifizierter du vielschichtiger Ausleseprozess statt, die Berufseinstiegsquote (also das erste vertragliche Engagement) liege dann aber bei immerhin 60 Prozent. Samantha Farber führt sodann zum eigentlichen Thema zurück, in dem sie betont, das es junge SängerInnen enorm schwer haben, überhaupt im Sängerberuf Fuß zu fassen und dabei so ziemlich alle Bedingungen akzeptieren müssen, die ihnen geboten werden. Dazu gehören nicht nur die Bedingungen bei Auditionen und Proben, sondern auch eine gewisse Inkompetenz bei den Verantwortlichen der Opernhäuser, wobei die Stimme allein oft gar nicht ausschlaggebend sei. Sie als Sänger-Agentin könne allerdings auch nicht viel machen im Sinne einer
Verbesserung, da sie die Brücke wahren müsse zwischen dem Haus und den Interessen der SängerInnen. In jedem Falle sei es besser für junge SängerInnen, zunächst in ein Ensemble zu gehen.

Dominique Meyer
Damit kommt das so wichtige Thema Opernstudio auf: Dominique Meyer bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass die Wiener Staatsoper keines habe, denn hier könnten die SängerInnen bestens auf die Berufslaufbahn vorbereitet werden. Ohne Opernstudio werde oft zu früh engagiert bzw. besetzt, bisweilen zu ihrem Nachteil. Das Stipendiatenprogramm der Staatsoper könne dieses Manko nicht ausgleichen, es gebe aber einfach nicht das erforderliche Geld für ein Opernstudio. Roland Geyer hingegen zeigt einen anderen Weg der Berufsvorbereitung mit seiner Politik auf, den jungen SängerInnen (zuletzt 8 Aufnahmen bei 170 Bewerbungen) zunächst einen Vertrag über 2 Jahre zu geben, so dass sie für diesen Zeitraum erst einmal abgesichert sind und sich voll auf das Rollenstudium konzentrieren können, diese auch in der Kammeroper vor Publikum spielen und in Nebenrollen im Theater an der Wien auftreten. Das Anfangsgehalt liege mit €2.000-3.000 über dem vergleichbarer Engagements in Deutschland. Auch wenn das nicht genug sei, seien die Erfahrungen bisher recht gut. Als Peter Edelmann die seiner Meinung nach zu häufige Entlassung junger Sänger nach ihren ersten Vertragsjahren moniert, entgegnet Dominique Meyer, das dies oft auch im Sine der Sänger liege, um Karriere zu machen „Die Vögel wollen fliegen…“ So etwas gehöre zu diesem komplexen Beruf einfach dazu.

Samantha Farber
Elisabeth Kulman wirft sodann die Frage auf, ob das Geld, dass offenbar da sei, nicht besser verteilt werden könne, also mehr zu den Menschen hin (Stichwort Elbphilharmonie Hamburg). Könne man nicht auch an den Produktionskosten und Ausstattungen sparen? Bei den hohen Fixkosten des Betriebs und der mittlerweile seit 15 Jahren gegebenen Deckelung der öffentlichen Subventionen beispielsweise der Wiener Staatsoper bei gleichzeitig substanziellem Inflationsverlust sieht Meyer eine mögliche Lösung in Koproduktionen. Das werde aber oft kritisiert, obwohl die Staatsoper auch früher schon viele Koproduktionen gemacht habe. Die Ausstattungen fallen mit etwa €3-4 Mio. pro Jahr allerdings im Budget der Staatsoper nicht so stark ins Gewicht. In Italien stelle sich die Situation noch viel schlimmer dar, Gehälter würden bisweilen bis zu zwei Jahre nicht gezahlt.
Meyer spricht bei dieser Gelegenheit aber ein ganz wichtiges Thema an, und zwar die Problematik, wenn SängerInnen aus irgendeinem Grunde einmal nicht mehr singen können, vor allem durch längere Krankheit. Hier hält der Betrieb kein Mittel bereit, solche KollegInnen aufzufangen und ihnen die Ausfallzeit finanziell abzufedern. So sollte die „Revolution der Künstler“, von der hier die Rede ist, auch diesen Aspekt mit der Suche nach einer Lösung einschließen. Davide Damiani, ein italienischer Opernsänger, stellt schließlich noch einen kürzlich gegründeten Verein zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von italienischen Opernsängern vor, die Cantori Professionisti d’Italia (CPI). Sie bemühen sich derzeit u.a. um die Erarbeitung eines einheitlichen Dienstvertrages, Verbesserung der Rahmenbedingungen und leisten Beratung.

Peter Edelmann
In der anschließenden Diskussion kristallisiert sich heraus, dass ein möglicher Weg zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der SängerInnen, und damit sind wohl in erster Linie die Freischaffenden gemeint, eine stärkere Solidarisierung untereinander sein kann, und möglicherweise sein muss. Dass eher das Gegenteil derzeit der Fall ist, wird kaum bestritten, der Zug zur Individualität ist offenbar sehr groß. In Salzburg, berichtet Betriebsrat Peschke, sei es beispielsweise nicht gelungen, Kollektivverträge für SängerInnen auszuhandeln, weil diese es nicht wollten. Elisabeth Kulman unterstreicht jedoch die Notwendigkeit zu einer Abwendung vom verbreiteten Egoismus hin zu mehr Solidarität. Allein, wie dies zu bewerkstelligen wäre, ist völlig offen und sicher kompliziert. Aber diese Einsicht allein scheint mir schon ein wesentliches Ergebnis des Prozesses „art but fair“ bisher zu sein. Sicher ist die Kunst in unserer Gesellschaft auch Marktbedingungen unterworfen, ob man das will oder nicht. Der Vorschlag einer Regisseurin, diese Marktsicht zurückzudrängen in einem Appell an die zuständigen Politiker, dass Kunst nicht mit normalen marktechnischen Kriterien zu behandeln sei, würde sicher ergebnislos bleiben. Politiker gehen in ihrer Mehrheit (leider) kaum in die Oper und die Wählerstimmen, die mit Aktionen hier gewonnen werden können, sind marginal (z.B. 6.000 KünstlerInnen in Österreich). Somit könnte eine mögliche Lösung meiner Meinung darin liegen, dass sich die Intendanten, die die ultimativen Entscheidungsträger in diesem Prozess sind, eine Art Ethik-Kodex auferlegen, um das aus dem politischen Desinteresse resultierende Vakuum im Sinne gerechter Bedingungen für künstlerische Arbeit auszufüllen. Das wäre gewissermaßen ein interner politischer Akt der Hauptverantwortlichen, um in diesem sensiblen Bereich ein größeres Maß an Humanität sicher zu stellen. Ob das gelingt, wenn es denn je gewollt wäre, steht in den Sternen.
Eines aber ist schon jetzt sicher: dass diese Podiumsdiskussion stattfand und von einer Reihe ihrer Teilnehmer auf die „beinharten“ Bedingungen des Sängerberufes mit einer gewissen Warnung auch an die Studierenden hingewiesen wurde, ist schon ein Erfolg an sich. Da wird noch mehr kommen. Was aber nicht kommen sollte, da völlig abwegig, ist der Vorschlag einer Professorin der mdw, neben dem Gesangsstudium offiziell alternative Studienfächer zum Parallelstudium anzubieten für den Fall, dass es mit dem Singen nicht klappt. Ich möchte mir nicht ausmalen, was die Dekane der anderen Fakultäten sagen würden, wenn die mdw plötzlich VWL, BWL, Medizin, Sport oder ähnliches im Alternativstudium anbieten würde… Eines sollte man am Ende aber nicht aus den Augen verlieren: es lässt sich im Leben nicht alles absichern, ein gewisses Risiko ist immer dabei. Letztlich muss der einzelne abschätzen, ob er es eingehen will. Einig waren sich jedoch alle, dass man für den Sängerberuf „brennen“ muss…
Fotos: Klaus Billand
Klaus Billand