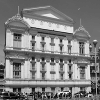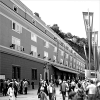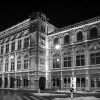FÜSSEN: Festspielhaus: 2 Symposien zum „Ring des Nibelungen“ von Sofia in Füssen - September 2015

Bürgermeister Paul Iacob eröffnete das Symposium
Zwei Symposien während der Aufführungen des „Ring des Nibelungen“ der
Nationaloper Sofia vom 12. bis 17. September 2015 im Festspielhaus in Füssen, Allgäu.
Begleitend zu Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ aus Sofia gab es zwei
international besetzte kurze Wagner-Symposien. Sie wurden konzipiert, um der Wagner-
Woche vom 12. bis 17. September im Festspielhaus eine zusätzliche informative Facette zu
verleihen, zumal sich in Füssen ein kenntnisreiches Publikum einfand.
Das erste Symposium fand am Tag der „Walküre“ in einem Seitenflügel des Festspielhauses
statt. Es widmete sich dem Thema: „Richard Wagner und König Ludwig II. von Bayern –
Wahrheiten und Vorurteile“.

Die Referenten des 1. Symposiums
Am Podium nahmen teil:
• Dr. Barbara von Orelli-Messerli, Privatdozentin für Kunstgeschichte,
Kunsthistorisches Institut der Universität Zürich
• Mag. Klaus Reichold, Die Histonauten („Wir vermitteln Geschichte“), München
• Vera Petrova, Managerin des Sofioter „Ring“-Projekts in Füssen

Das Publikum des 1. Symposiums
Zum ersten Symposium kamen über 70 Zuhörer.

Die Referenten des 2. Symposiums
Am Tag der „Götterdämmerung“ fand ebenfalls im Festspielhaus das zweite Symposium statt
mit dem Thema: „Wagnersches Regietheater und traditionelle, nahe an der Werkaussage
operierende Opernregie – Relevanz und Missverständnisse“. Seit den legendären „Ring“-
Produktionen von Joachim Herz 1973-76 in Leipzig, Ulrich Melchinger 1970-74 in Kassel
und Patrice Chéreau 1976 in Bayreuth redet die Opern- und vor allem die Wagnerwelt vom
Wagnerschen Regietheater, das heißt einem Musiktheater, das dem Regiekonzept und der sich
daraus ergebenden Theatralik das Primat vor der musikalischen Seite einräumt. Dagegen gibt
es immer wieder Bestrebungen, die sogenannte Werktreue mit einem klassischen Regiestil zu
pflegen, der wesentlich aus dem Neu-Bayreuth Wieland Wagners schöpft. Konsequenterweise
gibt es zu diesem Thema hitzige Diskussionen, bis hin zur Relevanz der Kunstgattung Oper
ganz allgemein.
Die Podiumsteilnehmer, alle bewährte Fachleute auf ihrem Gebiet, waren:
• Prof. Hans-Peter Lehmann, Regisseur, Assistent von Wieland Wagner im sogenannten
Neu-Bayreuth, Hannover
• Prof. Stephan Braunfels, Architekt und Enkel des Komponisten Walter Braunfels,
Berlin und München
• Ronald Aeschlimann, Regisseur und Bühnenbildner, Genf
• Tristan Braun, Regisseur, Berlin
• Vera Petrova, Managerin des Sofioter „Ring“-Projekts in Füssen

Prof. Hans-Peter Lehmann
Referent Prof. Hans-Peter Lehmann

Tristan Braun
Referent Tristan Braun, Regisseur, Berlin

Das Publikum des 2. Symposiums
Zum 2. Symposium kamen über 50 Zuhörer.
Die Symposien wurden von den Richard-Wagner-Verbänden Wien und Freiburg sowie von
der Stadt Füssen durch ihren Bürgermeister Paul Iacob, der auch beide Symposien eröffnete,
gesponsert.
Insbesondere nach dem zweiten Symposium gab es eine sehr angeregte Diskussion mit dem
Publikum. Die Moderation lag in beiden Symposien beim Verfasser dieses Artikels, der auch
die Symposien vorbereitet und die Referenten eingeladen hatte.
Zum Symposium „Richard Wagner und König Ludwig II. von Bayern“
PD Dr. Barbara von Orelli-Messerli betonte, dass das Verhältnis von Richard Wagner und
König Ludwig II. von Bayern anhand der Quellen zu beleuchten, ein Unterfangen sei, das nur
in beschränktem Umfang gelingen kann. Dies deshalb, weil Richard Wagner seine
Lebenserinnerungen (Mein Leben) nur bis zum Jahre 1864 führt, d. h. seiner Begegnung mit
König Ludwig II. Cosima von Bülow, die spätere Ehefrau von Richard Wagner, eröffnet ihre
Tagebücher am 1. Januar 1869. Daraus ergibt sich eine Lücke von fast fünf Jahren der
Zeugnisse der direkt Beteiligten, so dass insbesondere die Münchner Jahre, wie sie genannt
werden, ohne Zeugenschaft von Seiten Richards und Cosimas bleiben. Trotzdem gelingt es,
die Beziehung zwischen dem König und dem Komponisten recht genau aufzuzeigen.
Insbesondere die Tagebuchaufzeichnungen von Cosima zu Ende des Lebens des Meisters
ergeben, dass er sich als Mensch und Künstler dem König gegenüber überlegen fühlte, bei
aller Liebe, die er dem König gegenüber empfand. Doch dies war – so können wir schließen –
aus psychologischer Sicht Wagners Legitimierung, dass er Zeit seines Lebens vom König
finanziell abhängig war.
Mag. Klaus Reicholds Vortrag war gespickt mit kleineren und bedeutenderen Anekdoten
zum Verhältnis Richard Wagners zu König Ludwig II., die er auch mit einigen Dias
bebilderte. Er ging insbesondere auf die emotionalen Aspekte dieses Verhältnisses ein. König
Ludwig II. schätzte zwar die Musik Wagners über alles, war in Wahrheit aber noch mehr von
den mythischen Stoffen, die darin verarbeitet wurden, begeistert. Hier fand er etliche Bezüge
zu seinem eigenen Weltbild. Dieses offenbart sich eindrucksvoll in den Theatermalereien vor
allem in den Schlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein. Eine bedeutende Rolle
spielte dabei die Liebe, die Wagner in seinen Musikdramen thematisierte. Reichold ging auch
auf die Homosexualität Königs Ludwigs II. und seinen strengen Glauben im Katholizismus
ein. Deshalb warf seine Kenntnisnahme der Beziehung Richard Wagners zu Cosima einen
dunklen und lang währenden Schatten auf das Verhältnis des Königs zum Komponisten.
Weitere Aspekte einer zunehmenden Entfremdung Wagners und König Ludwigs II. waren
dessen gegen den Willen des Komponisten bewirkte Uraufführungen von „Das Rheingold“
und „Die Walküre“ am Hoftheater München sowie der nicht offen ausgetragene Unwillen
Wagners, ein von Gottfried Semper gestaltetes pompöses Opernhaus in München bauen zu
lassen. Wagner wollte nicht mit dem Festspielhaus beeindrucken, sondern allein mit seinen
Werken, allen voran dem „Ring des Nibelungen“.
Zum Symposium “Wagnersches Regietheater und traditionelle, nahe an der
Werkaussage operierende Opernregie, Relevanz und Missverständnisse”
Mit einem Zitat aus der Wiener „Presse“ vom 29. August 2015 angesichts der
Neuinszenierung des „Fidelio“ bei den Salzburger Festspielen eröffnete der Moderator das
Symposium: „Regisseure bringen die Oper um ihre Zukunft“. Zudem wurde von einem
„Inszenierungswahn“ gesprochen.
Vera Petrova betonte, dass man bei Wagner auf keinen Fall gegen die Musik und den Text
inszenieren sollte (was Frank Castorf in seinem Bayreuther „Ring“ derzeit ja vorführt – Anm.
d. Verf.). In Sofia schätzt man das Konzept des Regietheaters nicht. Man wollte mit dieser
„Ring“ Produktion vielmehr eine Fantasiewelt mit realen Bezügen zeigen, mit einem
durchaus modernen Ansatz, aber stets mit Blick auf die Bedeutung des Gesamtkunstwerks.
Prof. Hans-Peter Lehmann stellte zunächst auf seine lange Bayreuther Assistentenzeit ab
und betonte, wie sehr er schätzte, von Wieland Wagner auf den Grünen Hügel geholt worden
zu sein. Lehmann findet den Terminus Regietheater nicht gut. Er hält vielmehr das
Miteinander des gesamten Produktionsteams, wobei der Regisseur ein wesentlicher Teil ist,
für wichtig. Er soll insbesondere mit dem Bühnenbildner, aber auch mit dem Dirigenten
zusammenarbeiten. So würde die Konzentration auf die reine Regiearbeit vermieden.
Lehmann erinnert an seinen großen Förderer Eckehard Grübler in München, mit dem er als
Bühnenbildner eine langjährige Partnerschaft pflegte, in der jedoch immer auch ein enger
Kontakt mit dem Dirigenten gehalten wurde. Über allem steht bei Wagner jedenfalls der Sieg
der Liebe über den Egoismus!
Prof. Stephan Braunfels, dessen Großvater Walter Braunfels selbst Komponist war, hob die
außerordentliche Bedeutung des Textes bei Wagner hervor und betonte, wie bedeutsam die
Übertexte in der Oper sind. Er, Stephan Braunfels, hat seine Werke erst über den Text
verstanden, und Walter Braunfels kam durch Wagners „Tristan und Isolde“ zur Komposition.
Für Stephan Braunfels sind aber auch die Dirigenten sehr wichtig, mit denen eine
Kooperation in einer Neuinszenierung gesucht werden sollte. Er selbst hat sein erstes
Bühnenbild mit Nikolaus Lehnhoff als Regisseur gemacht, den er für einen der wichtigsten
Regisseure des 20. Jahrhunderts hält, und der nach seinem Tod nicht genug gewürdigt wurde.
Es gab damals beim „Lohengrin“ in Baden Baden große Textverständlichkeit und eine
exzellente Personenführung. Und auch das ist ganz „modern“ und zeitgemäß. Der Mythos ist
bei Wagner dazu der allgemeine Rahmen.
So sieht Braunfels das Regietheater als eine Strömung, die aus dem Schauspiel kommt,
welches aber nicht mit Musik arbeitet. Er ist der Überzeugung, dass bei gutem Regietheater
Text und Musik im Vordergrund stehen sollten. Das Bühnenbild sollte dabei schon den Gehalt der Oper als Ganzes zu erkennen geben – hier hat der Bühnenbildner ungeahnte
Möglichkeiten. Für den wohl besten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts hält Braunfels
Adolphe Appia, der ihn, der selbst Architekt ist, auch deshalb besonders interessiert, weil er
Architekt war. So war Braunfels beispielsweise von dem „Ring“ der Inszenierung von Robert
Lepage in New York nicht angetan, weil es keine stringente Personenregie gab – „Alle stehen
nur herum“. Das kam eher einem Showtheater gleich. Die Quintessenz ist die präzise
schauspielerische Darstellung und die Darstellung der Konflikte. Das läuft dann auf die Frage
hinaus: In welcher Form kennen Publikum und Sänger die Stoffe? Man muss die
entsprechende Übersetzung treffen, wobei das Handwerk im Vordergrund steht. Und jede
Arbeit bedeutet eine neue Suche, bei der viel Intuition und eine gute Kommunikation mit den
Sängern erforderlich sind.
Roland Aeschlimann findet beides aufregend, das Neue und das Alte, im Zusammenhang mit
Opern-Inszenierungen. Es soll auch durchaus mal etwas schief gehen. Für ihn ist der Raum
besonders bedeutsam, der akustisch adäquat für das jeweilige Werk geschaffen sein muss. Die
Sänger müssen in diesem Raum zurechtkommen. Um sie zu hochwertigen Leistungen
bringen zu können, muss man sehr darauf achten. Aber wie für Hans-Peter Lehmann, so ist
auch für Roland Aeschlimann die Zusammenarbeit des Inszenierungsteams von
entscheidender Bedeutung. „Es ist nicht einzusehen, dass der Dirigent oft erst kurz von der
Generalprobe kommt.“ Die besten Inszenierungen kommen dann heraus, wenn alle des Teams
bei jeder Probe dabei sind.
Tristan Braun, der junge Nachwuchsregisseur, der im Sommer bei den Bayreuther
Festspielen mit seiner Inszenierung des „Parsifal“ für Kinder einen großen Erfolg feierte, hält
die Musik oft für zu laut, um den so wichtigen Text zu verstehen. Für ihn ist die Oper ein
Genre des Sängers, ein Opernabend steht und fällt mit den Sängern. Und er plädiert für eine
feinere Ausgestaltung dieses Genres. Statt eines zu lauten Klangteppichs sollte man besser
den Mut zum Rezitativ haben. Was das Regietheater betrifft, so weist Braun darauf hin, dass
der Kanon mit etwa 75 Werken der Opernliteratur es einfach erforderlich macht, auch
zeitgenössisch zu inszenieren. Die Arbeit der Regisseure wird allerdings immer mehr von
einem Übertrumpfen geprägt, wobei die Öffnung des Marktes aber mehr Möglichkeiten und
Konkurrenz bietet. Man sollte sich grundsätzlich einmal fragen, wo man mit der Oper hin
will: Museum oder Innovation? Wenn man das Museum will, sind keine Neuinszenierungen
mehr erforderlich. Deshalb muss man ständig neue Formen der Interpretation finden. Frank
Castorf wird beispielsweise in Berlin sehr geschätzt, in Bayreuth funktionierte es hingegen
nicht. Braun hat den „Parsifal“ für Kinder auf eine Stunde herunter gekürzt, wobei er aber für
große Ausgewogenheit zwischen der Regie und den Sängern geachtet hat. Nur so kann man
das Beste aus den Sängern herausholen. Wichtig ist für ihn, dass die Emotionen der Oper und
das Live-Erlebnis an einem Opernabend erlebbar werden. Damit ist diese Kunstform übrigens
auch dem Kino weit voraus. Der Regisseur muss den ganzen Kontext der Oper begreifen und
daraufhin vorher die relevanten Rahmenbedingungen setzen nach den entsprechenden
Absprachen im Inszenierungsteam.
Zur Frage des Eingriffs in das Libretto:
Tristan Braun findet Eingriffe in das Libretto durchaus legitim. So kann man bei Händel
leicht eine Arie umstellen. Bei Wagner allerdings geht es nicht. Es sei denn, es ist sehr
fundiert, also es darf nicht willkürlich aus dem Gusto heraus geschehen. Bei seinem auf eine
Stunde gekürzten „Parsifal“ für Kinder war es aus naheliegenden Gründen legitim.
Stephan Braunfels hebt dazu hervor, dass es einen großen Unterschied macht, ob man bei
Händel oder Wagner Kürzungen vornimmt. Bei Strauss kann man hingegen schon mehr
kürzen – die Kürzungen ergeben nur allzu oft musikalische Brüche. Man sollte es deshalb
nicht machen. Auch bei Mozart geht es nicht.
Vera Petrova unterstreicht zum Thema des Kürzens, dass sie bei ihrem „Ring“ keine
Streichungen vorgenommen haben und das auch ablehnen, das Stück müsse so gespielt
werden, wie es vom Komponisten geschaffen wurde. Auf keinen Fall soll Operntheater ein
Museum darstellen. Es ist ohnehin viel Repertoire in den Theatern, und dieses verlangt nach
neuen Sichtweisen, aus dem Konzept des jeweiligen Stückes heraus. Idealerweise sollte sich
eine Kongruenz zwischen der eigenen Wahrnehmung und dem realen Leben ergeben.
Daraufhin entspann sich eine Podiumsdiskussion mit folgenden Schwerpunkten:
Zur Rolle des Publikums:
Für Tristan Braun ist von großer Bedeutung, wer das Publikum ist, wo man ist und worauf
man sich einstellt. Diese Fragen sollte man sich immer wieder stellen. Das hat ganz
entscheidenden Einfluss auf die Regiearbeit. Roland Aeschlimann meint, man sollte auch das
Publikum nicht unterschätzen – es ist ungemein wichtig. Für Stephan Braunfels hat das
Regieteam auch eine große Verantwortung für das Publikum. Niemand will immer dieselben
Inszenierungen sehen, bis auf ganz wenige. Also tut Wandel not.
Zu Kindern und Jugendlichen in der Oper:
Für Tristan Braun stellt sich hierbei die Frage, ob wir davon ausgehen können, dass die
Kinder später auch in die Opern gehen werden. In Berlin beispielsweise hat man für Kinder
und Jugendliche neue Formate entwickelt. So gibt es dort die Oper „Ariodante“ in einer
Kirche. Es ist schließlich eine Suche von Projekt zu Projekt, wie man die junge Generation an
die Oper heranführt.
Die anschließende, äußerst lebhafte und fast einstündige Diskussion mit dem Publikum drehte
sich im Wesentlichen um die von Tristan Braun aufgeworfene Grundsatzfrage: Wollen wir das Museum oder Innovation? Eine Meinung urgierte, aus dem Stück heraus und nicht von einem Außenthema her zu inszenieren. Wenn man so vorgeht, ist es egal, welches Werk man inszeniert. Man wird immer bei der relevanten Werkaussage bleiben. Dann kam die Frage auf, warum man das lange erarbeitete Verständnis bei Wagner zerstören müsse – sehr diskussionswürdig… Beim klassischen Ballett gebe es ja auch strenge Regeln. Eine ehemalige Opernsängerin meinte, man müsse die Freiheit der Kunst in jedem Falle verteidigen. Nur sei das Extreme abzulehnen. Um die Nichtakzeptanz von Inszenierungen zu dokumentieren, solle man eben einfach nicht mehr hingehen. Der Archivar Jean Luis Schlim, der auch im ersten Symposium am Rande mitwirkte, erwähnte die Leistungen von Peter Konwitschny, beispielsweise mit seinem „Fliegenden Holländer“. Der Moderator erwähnte zudem Florian Lutz mit seinen zeitgenössischen, aber in sich stimmigen Neuinszenierungen des „Lohengrin“ in Gera und des „Tannhäuser“ in Lübeck. Stephan Braunfels meinte schließlich dazu, das seien eher Ausnahmen, denn viele Regisseure erreichen nicht die Tiefe eines Peter Konwitschny.
Dieses kurze Symposium konnte zwar keine endgültigen Antworten auf die Frage geben,
welche Rolle das Regietheater bei Wagner und generell spielen sollte. Es hat aber eine ganze
Reihe der Facetten aufgezeigt, die diese immerwährende Diskussion bestimmen. Vielleicht
war es ein kleiner Beitrag zu dieser Diskussion.
Fotos: Klaus Billand
Klaus Billand